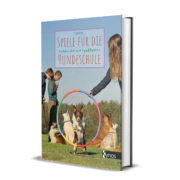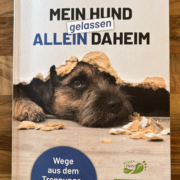Bindung zwischen Mensch und Hund
MYTHOS ODER MÖGLICHKEIT?

Bilder: Shutterstock.com
„Eine bessere Bindung“ und „eine engere Beziehung“ sind wohl die am häufigsten genannten Wünsche von mehr oder weniger verzweifelten Hundehaltern an unsere gemeinsame Trainingszielsetzung. Dabei bleibt meistens offen, wie sie den Begriff „Bindung“ oder „Beziehung“ definieren oder mit welchen Inhalten sie ihn füllen. Auch darüber, wie man eine Beziehung und daraus hervorgehend eine Bindung zu seinem Hund aufbaut, herrscht oft Uneinigkeit und Verunsicherung.
Es stellt sich die Frage: Worin liegt für den einzelnen Menschen mit Hund die Schwierigkeit, einen adäquaten und für beide Seiten annehmbaren Weg in eine vertrauensvolle Beziehung zu finden?
Ersichtliche Probleme sind:
- die uneinheitlichen Definitionen von Bindung,
- das Fehlen von wissenschaftlichem Basiswissen, sowohl auf Halter- als auch auf Hundeschulseite,
- ein unübersichtlicher Markt an unterschiedlichsten Trainingsphilosophien,
- überzogene, unerfüllbare Erwartungen an den vierbeinigen Lebenspartner.
Sich auf gleiche Definitionen zu verständigen, ist für eine erfolgreiche Arbeit und funktionierende Kommunikation unabdingbar. Erst wenn Sender und Empfänger über die gleichen Dinge sprechen, werden aus Worten, Gesten und Mimik verständliche Informationen, die beiden Seiten gleichermaßen zugänglich sind. Zu einem erfolgreichen Training gehört für mich immer eine genaue Formulierung des Trainingsziels. Erst wenn Trainer:in und Hundehalter:in sich einig darüber sind, was sie eigentlich genau vermitteln wollen, wird Training möglich. Trainingsziele exakt zu formulieren bedeutet, sich sehr zu fokussieren und ist selbst bei vermeintlich einfachen Übungen wie „Sitz“ nicht leicht. Ein Eckpfeiler eines erfolgreichen, lösungsorientierten Trainings ist eine deutlich formulierte Zielsetzung. Positiv verstärkendes Training wird sich zudem um eine Lösung bemühen, die sich auf „Was soll Ihr Hund stattdessen zeigen?“ konzentriert und nicht versuchen, ein vermeintlich störendes Verhalten mittels positiver Strafen abzubauen. (Positive Strafe = ein Strafreiz als unangenehme Konsequenz für den Hund wird hinzugefügt, wie z.B.: Leinenruck, FisherDisc, Rappeldose, Würge-/Stachelhalsband, Wasserspritze, Zischen, Aufstampfen etc.pp.)

Einem Menschen den Satz: „Ihr Hund hat ja gar keine Bindung zu ihnen!“ mit auf den Weg zu geben, ist wenig hilfreich. Im Gegenteil, er weist auf ein Defizit hin, das eine vermeintliche (Mit-)Schuld impliziert. Sollten Sie als Hundehalter mit diesem Vorwurf konfrontiert werden, geben Sie den verletzenden Schmetterball einfach butterweich gepritscht zurück. Fragen Sie einfach nach, woran sich diese Behauptung festmacht. Spätestens nach dem dritten „Warum?“, bricht Ihr Gegenüber ein. Jeder, der schon mal mit einem Vierjährigen die endlose „Warum-Schleife“ geflogen ist, weiß was ich meine. Retournieren Sie, falls Sie entnervt abgewiegelt oder abgewatscht werden, mit: “Mir mag vielleicht eine Bindung fehlen, aber Ihnen fehlen offenbar die Antworten, um mir zu helfen.“ Damit haben Sie den Ball gekonnt zurück gespielt und Sie schleppen ihn nicht als unnötigen Ballast mit sich herum.
Mein Fazit: Die Chance, wirkliche Hilfe zu erhalten, ist dort am wahrscheinlichsten, wo Sie auf ein qualifiziertes, empathisches Gegenüber treffen, das Sie und Ihren Hund ernst nimmt. Eine Trainer:in kann nicht alles wissen, aber was er/sie vermittelt, kann er/sie nachvollziehbar wissenschaftlich begründen. Findet er/sie keine Lösung, so wird er/sie dies ehrlich kommunizieren, es recherchieren, eventuell einen Kollegen:in/Spezialisten:in hinzuziehen, aber bestimmt nicht die Schuld an seine Kunden:innen oder deren Vierbeiner weiter geben. Er/sie wird mit seinem Sachverstand die Situation beobachten, analysieren, einen Trainingsplan erstellen, diesen vermitteln und mögliche Probleme, aber auch Erfolge begleiten – die alltägliche Bereitschaft, mit dem eigenen Fellkind liebevoll und geduldig zu arbeiten, liegt aber immer in der Verantwortung des Hundehalters.
GIBT ES DAS?

Worin liegt die scheinbar unwiderstehliche Anziehung zwischen dem Primaten „Mensch“ und dem Caniden „Hund“ und ist es beiden überhaupt möglich, eine Bindung aufzubauen?
Antworten über Bindungsfähigkeit und Folgen von fehlenden frühkindlichen Bindungen finden wir u.a. bei John Bowlby (1907-1990).
Bowlby, britischer Kinderarzt und Psychoanalyst, entwickelte in den 50er Jahren die sogenannte Bindungstheorie. Er stellte die Hypothese auf, dass die Suche und Verwirklichung von sozialen Bindungen in uns Menschen evolutionär verankert und ein Grundbedürfnis ist. (Grossmann, K.E. & Grossmann, K. (Hrsg.) (2003). Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie und Forschung. Stuttgart, Klett-Cotta.) Er versuchte seine Theorie auf einer Basis von Verhaltensforschung und Psychoanalyse bei menschlichen Säuglingen nachzuweisen. Es gibt an Menschen aus ethischen Gründen noch sehr wenige empirische Studien zur Bindungstheorie. In den 70er Jahren entwickelte Mary Ainsworth (US-amerikanische Entwicklungspsychologin) auf der Grundlage der Bindungstheorie einen nicht unumstrittenen Test an Kleinkindern. Es war der „Fremde-Situation-Test“. Dieser hatte das Ziel, die Kriterien einer sicheren Mutter-Kind-Bindung nachzuweisen.
Für Hunde bzw. Säugetiere weist Jaak Panksepp in seinem Buch „Affective Neuroscience“ (S.246 ff) in Tierversuchen nach, dass die Fähigkeit/das Bedürfnis, sich zu binden, ähnlich angelegt ist. Der von Mary Ainsworth für Kinder entwickelte Test wurde 1989 zum ersten Mal von Heinz Weidt auf Hunde übertragen. 1997 publizierten Dina Berlowitz und Heinz Weidt weitere Versuchsergebnisse ( Heinz Weidt, Dina Berlowitz: Sichere Bindung – sicheres Wesen. In: Schweizer Hunde Magazin 9/1997).
Einen größer angelegten Test nach Ainsworth gab es 1998 unter der Leitung von Dr. Àdàm Miklòsi (Universität Budapest). Die Ergebnisse der ungarischen Forscher kann man auf ihrer Seite familydogproject.elte.hu/attachment.html verfolgen und auch in dem 2011 erschienen Buch „Der Hund“ von Dr. Adam Miklosi (S.70 ff) nachlesen. Die Rückschlüsse, die von Verfechtern der Bindungstheorie gezogen werden, überschneiden sich in den wichtigen Punkten. Schlussendlich sind die Erwartungshaltungen bzw. das Grundbedürfnis nach sicheren sozialen Bindungen bei Hund und Mensch gleich gelagert. Die zu erwartenden Folgen von unsicheren, fehlenden sozialen Beziehungen sind für Mensch und Hund vermutlich gleichermaßen zerstörend und weittragend. Dies sollte man in jedem Fall in Bezug auf Tierschutzhunde und deren Integration in einen Menschenhaushalt im Hinterkopf behalten. Hundewelpen, geboren von einer scheuen Hündin, die selbst ohne Bezug zum Menschen lebt, werden sich allenfalls an ein Leben im Haushalt gewöhnen. Zu einer wirklichen Bindung wird es jedoch nicht kommen. Man müsste diese Welpen schon sehr früh in Berührung mit Menschen bringen und sozialisieren, damit eine Vermittlung in Menschenhand überhaupt Sinn macht.
Fazit: Hunde und Menschen sind nicht nur bindungsfähig, sie brauchen soziale Bindungen wie die Luft zum Atmen. Fehlende Bindung gerade in einer sehr frühen Entwicklungsphase macht psychische, aber auch physische Erkrankungen als Spätfolgen wahrscheinlich. Lebt bei Hunden die Elterngeneration schon „wild“, also ohne Menschenkontakt, werden auch deren Welpen keinerlei Bezug zum Menschen haben und scheu bleiben. Eine positiv erlebte Beziehung ab frühester Kindheit hilft dagegen für ein selbstbestimmtes, bindungsfähiges, selbstbewusstes Erwachsensein.
WELCHE BEDÜRFNISSE ERFÜLLT EINE SICHERE BINDUNG?
 Eine sichere Bindung wird nach psychologischen Maximen und auf erziehungswissenschaftlicher Ebene an ganz bestimmten Voraussetzungen fest gemacht.
Eine sichere Bindung wird nach psychologischen Maximen und auf erziehungswissenschaftlicher Ebene an ganz bestimmten Voraussetzungen fest gemacht.Aus Sicht des Kindes (Bonding):
- Geborgenheit
- Schutz
- Möglichkeit Erkundungsverhalten (Exploration) zu zeigen
- emotionale Erwartungssicherheit.
Aus Sicht der Eltern/Bezugsperson (Attachement):
- Fürsorge
- Interaktion
- Konfliktfähigkeit
- Zärtlichkeit
Nun kann man natürlich einwenden, dass sich diese Untersuchungen auf die zwischenmenschliche Ebene beziehen und nicht auf die Bindung zwischen zwei artfremden Wesen. Die oben erwähnten Studien und Versuche von Panksepp, Miklòsi und Weidt/ Berlowitz sprechen jedoch eine deutliche Sprache.
Ein weiteres Argument liegt in der Art, wie wir Hunde in den letzten 15 Jahren in unsere Gesellschaft integriert haben. Schauen wir uns doch einmal die Stellung des Hundes in der heutigen Zeit an.
Was haben Hunde und Kinder gemein?
Objektiv betrachtet eine Menge. Und falls sich diese Frage der Leser:in gerade aufdrängt – ich kann das durchaus beurteilen, da ich seit vielen Jahren auch die Bezugsperson für ein wunderbares Menschenkind bin. Beide haben keine Wahl, ob sie bei diesem oder jenem Menschen sein wollen, sie sind in einer fremden Umgebung auf Hilfe und Richtungsweiser angewiesen, sie sind ihrem Menschen hilflos ausgeliefert, sie leben als Familienmitglieder bei ihrem Menschen, sie haben das Bedürfnis nach Bindung zu einer festen Bezugsperson. Da schließt sich auch der Kreis.
Fazit: Die “Bindung”. Sie ist ein überlebenswichtiges Grundbedürfnis, sie ist die Schnittmenge, sie ist (mit)verantwortlich für die unwiderstehliche Anziehung zwischen Menschen und Hunden.
WORAN ERKEANNT MAN EINE BESTEHENDE BINUNG?
Woran erkenne ich eine bestehende Bindung und woran nicht?
Was eine beidseitig befriedigende Bindung ausmacht, haben wir bereits geklärt. Ebenso, dass es sowohl für uns, als auch für unseren Hund sehr erstrebenswert erscheint, eine solche Bindung aufzubauen und zu leben. Trotz allem ist die Wahrnehmung des Bindungsstandes zum eigenen Fellkind sehr subjektiv. Gern verunsichert uns der direkte Vergleich mit anderen Hund-Halter-Teams. Neidvoll blickt so mancher Hundehalter:in auf Vierbeiner, die an ihrem Zweibeiner geradezu kleben, ihn keine Sekunde aus den Augen lassen, immer und überall ansprechbar zu sein scheinen. Schaut man dann ans andere Ende der eigenen, immer gestrafften Schleppleine und sieht seinen geliebten Hund voran strebend, bestenfalls von hinten, immer bereit, die Umweltreize aufzunehmen und zu erkunden, ohne auch nur ein Ohrzucken in unsere Richtung, können einem da schon mal Zweifel an einer funktionierenden Beziehung kommen.
Und zu Hause? Was ist schief gelaufen, wenn wir keinen Kampfschmuser an unserer Seite haben, der sich am liebsten im geliebten Menschen wälzen möchte? Ist es ein Zeichen von beziehungstechnischer Schieflage, wenn unser Puschelhund kein Kuschelhund sein möchte?
Zu den Hunden, die als Paradebeispiel für ihre tiefe Liebe zum Menschen herhalten müssen, denen gerne ein sogenannter “will to please” unterstellt wird, gibt es Einiges kritisch anzumerken. Diese Hunde wurden seit Generationen auf Kooperationsbereitschaft zum Menschen selektiert, dabei zeichnet sie eine sehr große Beobachtungsgabe und Sensitivität in Bezug auf menschliche Körpersprache aus. Wie ist die entstanden? Diese Hunde sind sehr leicht hemmbar und reagieren extrem sensibel auf Strafe, sie versuchen jeden Konflikt mit ihrem Menschen zu vermeiden, indem sie sehr schnell auf dessen Signale reagieren. Betrachtet man die Kehrseite der Medaille des “will to please” wird klar, dass diese Eigenschaft wenig bis gar nichts mit eigenem Willen oder Freude zu tun hat. Jede Form von Verniedlichung, Ausbeutung oder Verherrlichung dieser Eigenschaft kann ich weder teilen, noch mag ich eine gute Bindung daran fest machen. Schwierigkeiten machen uns die Hunde, deren Zuneigung weit weniger deutlich gezeigt wird bei Rassen, die erwachsen werden und kaum über Spiel oder Sozialkontakt zu begeistern sind. Bezeichnenderweise sind es diese Hunde bzw. Rassen, denen gern das Stigma der Sturheit, Unerziehbarkeit, Dummheit und nicht zuletzt Gefährlichkeit unterstellt wird. Diese Hunde bauen ebenso eine Bindung zu ihren Menschen auf wie alle anderen, sie leben sie nur anders aus. Zu guter Letzt noch ein Wort zu der weit verbreiteten Behauptung, dass ein Hund, der beispielsweise jagen geht, obwohl sein Halter ihn mit einem Belohnungshäppchen gerade abrufen möchte, keinerlei Bindung hat. Diese Behauptung ist schlicht und ergreifend falsch.
Jagen und Bindung sind kein Paradoxon. Hunde gehen jagen, wenn sie eine hohe Jagdmotivation haben, mit oder ohne Bindung. Hier wäre es wichtig, uns mit dem Jagdverhalten von Hunden auseinander zu setzen und mit unserem Jagdräuber an hochwertig verstärkten Alternativen zum Jagen zu arbeiten. Das hilft dann nebenbei der so heftig ersehnten Bindung.
FAZIT:
Eine funktionierende Bindung manifestiert sich in einem gegenseitigen Vertrauen und einer hohen Erwartungssicherheit. Häufig kann man als Mensch dieses Vertrauen an bestimmten Verhaltensweisen des eigenen Hundes festmachen wie freiwillige Kontaktaufnahme, Kooperationsbereitschaft, Pflegeverhalten, Kontaktliegen, Einladungen zum Kuscheln usw. Sind diese Verhaltensweisen aber nicht so offensichtlich, sagt das zunächst einmal nichts über die Bindung, sondern über die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse jedes Individuums aus. Ein Hund, der in seinem Hundebett entspannt auf dem Rücken liegt, sich in Konflikten umorientieren und auf ein Alternativverhalten einlassen kann, zwar den Menschen, aber nicht seine Nähe sucht, kann ebenso viel Bindung zu seinem Menschen haben wie der Knuddelkönig, der “Mitten drin, statt nur dabei!”, zum Lebensmotto hat.
Wichtig ist, dass selbst die beste Bindung der Welt keine Befriedigung für alles sein kann. Heißt: Ein Hund ist ein Hund, ein Hund bleibt ein Hund, ein Hund kann gar nicht anders – das ist gut und richtig so.