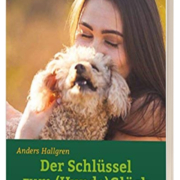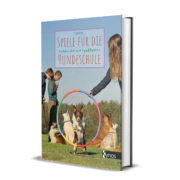SOCIAL SUPPORT: Warum du deinen Hund trösten darfst und für ihn da sein sollst
WAS BEDEUTET SOCIAL SUPPORT ÜBERHAUPT?
Social Support oder soziale Unterstützung bezeichnet das Verhalten von Bindungspartnern, die sich in stressigen oder beängstigenden Situationen gegenseitig durch körperliche Nähe unterstützen. Dieses Verhalten ist bei verschiedenen Tierarten zu beobachten, die in Gruppen leben, wie zum Beispiel Hunde, Wölfe, Pferde und insbesondere auch beim Menschen. Hunde zeigen beispielsweise ein starkes Bedürfnis nach Nähe zu kranken oder verletzten Familienmitgliedern (sowohl Hunde als auch Menschen) und verbringen viel Zeit in ihrer Nähe, oft ohne von ihrer Seite zu weichen.
Immer wieder stellt sich die Hunde-Community die Frage:
Darf ich meinen Hund trösten?
Oder verstärke ich damit nur seine Angst?

Bilder: Canva
Dazu müssen wir uns erstmal die Frage beantworten:
WAS IST ANGST ÜBERHAUPT?
Angst ist eine negative Emotion, die dem Körper ermöglicht, sich schnell an potenziell gefährliche Situationen anzupassen und dann auch entsprechend rasch zügig zu reagieren. Ob eine Situation als bedrohlich angesehen wird oder nicht, entscheidet die Amygdala. Sie ist ein Teil des limbischen Systems, welches für die Entstehung, Verarbeitung und Erkennung von Emotionen verantwortlich ist. Wenn die Amygdala einen Reiz als bedrohlich einstuft, werden Stresshormone freigesetzt und eine Angstreaktion ausgelöst, was zu zahlreichen physiologischen Reaktionen im Körper führt:
Einige sind leichter zu erkennen:
- Erhöhte Atemfrequenz / Hecheln
- Erhöhter Muskeltonus
- Erweiterte Pupillen
- Veränderung des Speichelflusses
- Urinieren und Koten
- Evtl. Aufgerichtete Haare im Nacken und/oder Rückenbereich (Piloerektion)
Andere nicht so leicht:
- Herzrasen
- Steigender Blutdruck
- Verlangsamte Verdauung
- Schwitzen über die Pfotenballen
Leider ist die Einschätzung der Amygdala äußerst ungenau und nicht bewusst kontrollierbar – dennoch wird sie äußerst schnell erlernt, da es im Zweifelsfall lebenswichtig ist, lieber einmal zu viel zu reagieren als einmal zu wenig. Es ist also völlig normal und grundsätzlich angemessen, dass unsere Hunde Ängste verspüren. Es liegt nun an uns, unsere Hunden dabei zu unterstützen, mit diesen Ängsten umzugehen oder sie sogar zu überwinden.
Die nächste Frage die wir uns in diesem Zusammenhang stellen sollten:
WAS PASSIERT MIT EINER EMOTION, WENN ICH AUF DIESE MIT EINER BESTIMMTEN ART REAGIERE?
In den meisten Fällen führen unsere Reaktionen auf das Verhalten unserer Hunde zu einer emotionalen Reaktion bei den Hunden:
- Hinzufügen von etwas Positivem = Freude (Verstärkung)
- Hinzufügen von etwas Negativem = Angst (Strafe)
- Entfernen von etwas Negativem = Erleichterung (Verstärkung)
- Entfernen von etwas Positivem = Frustration, Traurigkeit (Strafe)
Achtung: Die Art und Weise, wie unsere Hunde positive und negative Signale interpretieren, hängt vom individuellen Empfinden und der aktuellen Verfassung des Hundes ab. Beobachte, ob deine gut gemeinten Aktionen auch tatsächlich positiv vom Hund empfunden werden. Deshalb ist es unabdingbar, das Ausdrucksverhalten deines Hundes bereits gut kennen. Wenn du in einer angstauslösenden Situation für den Hund noch ein negatives Gefühl oben drauf packen (wenn auch unabsichtlich) wird er die Situation noch schlimmer bewerten.
Beispiel: Wenn dein Hund sich, wie die meisten Hunde, unwohl dabei fühlt, wenn du dich über ihn beugst und von oben über seinen Kopf streichelst, dann solltest du das auch nicht in einer sowieso schon für ihn bedrohlichen Situation machen. Versuche stattdessen, dich neben ihn zu setzen und seine Schulter oder Brust zu kraulen.
Das heißt:
Positive Emotionen können verstärkt werden, wenn noch etwas Positives hinzugefügt wird.
Beispiel: Du bist auf einer Veranstaltung und triffst viele nette Menschen, die deine Werte und Interessen teilen. Auf einmal kommt ein alter Freund um die Ecke, den du lange nicht gesehen hast = Deine Freude wird noch größer, die Emotion noch positiver.
Positive Emotionen können abgeschwächt werden, wenn etwas Negatives hinzugefügt wird.
Beispiel: Du bist wieder auf der genannten Veranstaltung und freust dich. Auf einmal erhältst du die Nachricht, dass dein alter Freund doch nicht kommen kann = Deine vorherige Freude bekommt erstmal einen Dämpfer
Negative Emotionen können verstärkt werden, indem noch mehr Negatives hinzugefügt wird.
Beispiel: Du hattest eine Meinungsverschiedenheit mit deiner Freundin. Auf dem Nachhause weg nimmt dir jemand die Vorfahrt = Deine negativen Emotionen verstärken sich. Die Laune sinkt. Du fühlst dich vielleicht frustriert, wütend oder ärgerlich.
Negative Emotionen können abgeschwächt werden, indem etwas Positives hinzugefügt wird.
Beispiel: Du hattest einen Meinungsverschiedenheit mit deiner Freundin. Deine Lieblings Kollegin hat dir ihre selbstgebackenen Muffins mitgebracht, die du so magst = Du fühlst dich besser, erleichtert – die negativen Emotionen werden abgeschwächt.
Übertragen auf unser Beispiel heißt das:
Wenn wir unserem Hund in einer angstauslösenden Situation etwas Gutes tun, für ihn da sind und z.B. ihm durch körperliche Nähe durch die Situation helfen, verbessert das im besten Falle seine Gefühlslage und wir geben ihm Halt und Sicherheit.
Eine negative Emotion kann durch das Hinzufügen von etwas Positiv empfundenen nie verstärkt werden!
Wenn unser Hund jetzt also auf den Grooming-Tisch gestellt wird und Schutz bei uns sucht, wird es seine Angst nicht vergrößern, wenn er entspannend und beruhigend berührt wird oder eine Schleckmatte bekommt. In der Groomingbranche ist es leider durchaus Usus, dass die Hundehalter:innen in einem gewissen Abstand zum Tisch warten müssen, oder gar des Salons verwiesen werden. Sucht dein Hund nun Schutz und Beistand bei dir, seinem engen Vertrauten und Freund, sollte dieser auf gar keinen Fall verwehrt werden. Dies wird auf Dauer zu einem hohen Vertrauensverlust kommen!
Körperliche Zuwendung eines Bindungspartners führt zu Oxytocin-Ausschüttung (das “Bindungs-” oder “Kuschelhormon”). Und Oxytocin bewirkt als Gegenspieler zum Stresshormon Cortisol dessen Senkung. Das alles führt zur Senkung des Blutdrucks und der Herzfrequenz. Der Hund entspannt langsam, kann wieder „klarer“ denken und die Situation wieder als bewältigbar einstufen.

ACHTUNG! AUSNAHME
Wenn du, z.B. beim Anblick einer Spritze beim Tierarzt selbst in Panik verfallen würdest, kann sich diese Stimmung zusätzlich auf den Hund übertragen. Die oben genannten Strategiemöglichkeiten setzen voraus, dass du selbst gelassen bleiben und dadurch deinem Hund Ruhe und Gelassenheit vermitteln kannst. Ist dem nicht so, hole dir Unterstützung von Bezugspersonen die dein Hund gut kennt und denen er vertraut, die deinen Hund entspannt durch solche Situationen begleiten können. Die Anwesenheit eines Vertrauten kann dazu beitragen, dass die Angst beim nächsten Mal entweder gar nicht auftritt oder zumindest nicht so stark ist. Ihr Hund gewinnt in jedem Fall das Vertrauen, dass er nicht alleine mit dieser schwierigen Situation umgehen muss!
(Beitrag aktualisiert 15. Februar 2024)