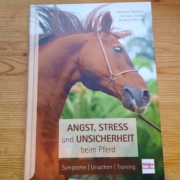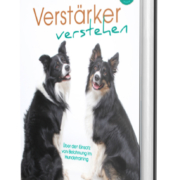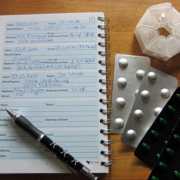Bindung, Co-Regulation, Selbstregulation, Impulskontrolle, Selbstwirksamkeit und Soziales Referenzieren beim Hund
DEFINITIONEN, ZUSAMMENHÄNGE UND BEDEUTUNG
FÜR DAS ZUSAMMENLEBEN MIT DEM HUND
Es tut sich einiges in der positiven Hundeszene! Lange war das belohnungsbasierte, behavioristische Training für uns der “Heilige Gral”. Auch für mich war das so. Nach meinen aversiven Anfängen in Sachen Hund 2001, begann ich 2006 meine Ausbildung bei CumCane und habe dort von der biologischen Pike auf gelernt, wie Hunde lernen, wie Verhalten entsteht usw. Ich habe unzählige Fortbildungen gemacht, alle ausschließlich bei gewaltfrei arbeitenden Kolleg:innen. Von den Trainer:innen der Tierakademie Scheuerhof habe ich unglaublich viel über behavioristisches Trainingshandwerk gelernt. Mir hat dabei nicht alles gefallen. Was mir oft gefehlt hat, war die echte Verbindung zum Hund.
Ein Hund ist nicht nur Biologie, ein Hund ist nicht nur ein beliebig durch gutes Training manipulierbares Wesen. Ein Hund ist so viel mehr. Ein hochsoziales Lebewesen, das in seiner Verbindung zum Menschen einzigartig ist im Tierreich, ausgestattet mit einem reichen und komplexen Innenleben.
Dieser Tatsache wird der rein biologisch-behavioristische Ansatz nicht gerecht und glücklicherweise ist da noch viel mehr und die Wissenschaft findet immer neue Dinge heraus darüber, was Hunde können, was sie sind und wie besonders die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist.

Hunde sind so viel mehr als Biologie und durch gutes Training manipulierbare Lebewesen. Sie sind hochsoziale Lebewese, die in ihrer Verbindung zum Menschen einzigartig sind im Tierreich, ausgestattet mit einem reichen und komplexen Innenleben. (Bilder: Maria Rehberger)
2016 veröffentlichte Mirjam Cordt die erste Version ihres Buches “Die sichere Bindung ist die beste Erziehung”. Damals schon eine Schatztruhe hinsichtlich der Erkenntnisse aus der Bindungsforschung, ist die im Jahr 2024 erschienene Neuauflage noch einmal überarbeitet und ergänzt worden und aus meiner Sicht das derzeit umfassendste Werk zum Thema Mensch-Hund-Bindung.
In den Jahren dazwischen hatte ich das Glück, Dr. Iris Schöberl kennenzulernen und von ihr noch viel mehr über das Thema Bindung zu lernen. Und wie das immer so ist, eins führt zum anderen, ich kam vom Hölzchen aufs Stöckchen und habe immer mehr Puzzleteile zusammengesammelt, die letzten Endes zu meiner heutigen Sicht auf die Dinge geführt haben: Behavioristisches Training hat nach wie vor seinen Platz im Leben mit meinen Hunden und in der Arbeit mit meinen Kund:innen und deren Hunden, genauso wie selbstverständlich die Biologie. Hier insbesondere das, was man heute über die Fähigkeiten von Hunden weiß. Nämlich, dass sie beispielsweise Emotionen anhand der Gesichtsausdrücke von Menschen ablesen können, dass sie kleinste hormonelle Veränderungen riechen können, dass sie sich enger an Menschen binden als an Artgenossen und dass sie Zeigegesten des Menschen besser interpretieren können, als unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Einen weit bedeutenderen Anteil macht für mich inzwischen aber die Psychologie aus, aus der viele der Erkenntnisse in Bezug auf Bindung und soziales Lernen hervorgehen.
Für mich ist es die Kombination aus allen Teilbereichen mit einem deutlichen Schwerpunkt auf der Mensch-Hund-Beziehung als solcher, die das Leben mit dem Hund rund macht. Und gerade auch bei problematischen Verhaltensweisen zeigt sich, dass die sichere Bindung, die dadurch möglich werdende Co-Regulation, das Fördern von Selbstregulation und Selbstwirksamkeit beim Hund und das soziale Referenzieren so viel mehr beim Hund verändern, als nur sein Verhalten. Anstatt einfach nur Alternativverhalten aufzutrainieren und den Hund in einer mehr oder weniger starken Abhängigkeit vom Menschen zu halten, haben wir die Möglichkeit den Hund beim persönlichen Wachsen zu begleiten und zu unterstützen. Dieses Wachstum führt letzten Endes dazu, dass Hunde Optimismus und Resilienz entwickeln und etwaige Ängste abbauen können, der Mensch als Bindungspartner in unklaren Situationen vom Hund freiwillig und vertrauensvoll als Orientierung herangezogen wird und Training von Verhaltensweisen auf Signal, die für ein stressfreies Leben in unserer Gesellschaft notwendig sind (z.B. Rückruf, auf dem Weg bleiben, Pflegemaßnahmen, etc.), völlig problemlos funktioniert.
Wie schon zu Beginn erwähnt: Es tut sich einiges in der positiven Hundeszene. Allerdings stolpere ich immer wieder über teils haarsträubende Aussagen in Bezug auf Co- und Selbstregulation, Selbstwirksamkeit und das ganze Drumherum, weshalb ich mit diesem Blogartikel unbedingt Licht ins Dunkel bringen möchte. Denn was ich erlebe ist, dass Hundehalter:innen (und auch Kolleg:innen) von den unterschiedlichen und teilweise nicht einmal logisch begründeten Erklärungen maximal verwirrt sind und der gesamte Themenkomplex droht in Richtung Esoterik, Mythen und Sagen abzudriften, wo er definitiv nicht hingehört. Denn wir haben im psychologischen Bereich genau wie im behavioristischen Bereich viele belegbare Forschungsergebnisse aus dem Humanbereich und auch immer mehr, die zeigen, dass diese Erkenntnisse ganz oder in weiten Teilen auch auf Hunde bzw. die Mensch-Hund-Beziehung übertragbar sind. Mal ganz davon abgesehen, dass im behavioristischen Bereich viele Forschungsergebnisse von Nagetieren auf Menschen und Hunde übertragen wurden und werden, aber das nur am Rande.
Entsprechend liefere ich im Folgenden die Definitionen bzw. dahinter stehenden Konzepte der Kernbegriffe. Ich setze sie auch zueinander in Beziehung und gebe Beispiele, wie sie sich im Zusammenleben mit dem Hund zeigen und auch gezielt nutzen lassen, um die Lebensqualität von Hund und Mensch (weiter) zu verbessern.
Ich versuche meine Erklärungen so einfach wie möglich zu halten, was bei einem so komplexen Thema leider ganz und gar nicht einfach ist. Deshalb verzichte ich weitestgehend auch auf die Nennung einzelner Studien, sondern verlinke hier die maßgeblichen Wissenschaftler:innen hinter den Theorien und Konzepten. So kann jede, die möchte, auf eigene Faust an den für sie interessanten Stellen tiefer in die Materie eintauchen.
Bindung
Die Bindung zwischen Mensch und Hund ist eines der Kernkonzepte im Zusammenleben mit dem Hund. Die Bindungstheorie geht in weiten Teilen zurück auf die Forschungsarbeiten von Mary Ainsworth, einer US-amerikanischen Entwicklungspsychologin.
Sie identifizierte unterschiedliche Bindungsmuster:
- Sichere Bindung
- Unsicher-vermeidende Bindung
- Unsicher-ambivalente Bindung
- Desorganisierte Bindung
Bindung ist
- das emotionale Band, das uns verbindet.
- gekennzeichnet durch Bindungsverhalten.
- gekennzeichnet durch Fürsorgeverhalten.
- ein Faktor der Stress- und Emotionsregulation maßgeblich beeinflusst.
Forschungsarbeiten u.a. an der Vetmed Uni Wien (Prof. Dr. Kurt Kotrschal, Dr. Iris Schöberl) zeigen, dass die Erkenntnisse der Bindungsforschung aus dem Humanbereich in weiten Teilen auch auf die Mensch-Hund-Bindung übertragbar sind.
Im Zusammenleben mit dem Hund sollte unser oberstes Ziel das Herstellen und Aufrechterhalten einer sicheren Bindung sein.
Denn:
Ist ein Hund sicher gebunden
- hält er sich gern in unserer Nähe auf.
- traut er sich, Neugier- und Erkundungsverhalten zu zeigen.
- sucht er in Stresssituationen unsere Unterstützung (Co-Regulation!).
- vertraut er uns, wodurch herausfordernde Situationen leichter bewältigbar werden.
- ist Training einfacher.
Sichere Bindung entsteht, wenn wir
- verfügbar, zuverlässig, fürsorglich und berechenbar sind.
- Ängste und Sorgen des Hundes ernst nehmen.
- ihm Unterstützung, Sicherheit und Schutz bieten.
- wohlwollend und liebevoll sind.
- feinfühlig auf Signale und Bedürfnisse eingehen.
Aversive Einwirkungen jeder Art zur gezielten Verhaltensbeeinflussung wie Leinenrucke, körperliches Blockieren und Bedrohen (aktuell gern als Raumverwaltung bezeichnet), Werfen mit Gegenständen auf und nach dem Hund, etc. verhindern die Entstehung einer sicheren Bindung!
Der Hund wird im Normalfall trotzdem eine Bindung zum Menschen aufbauen, allerdings wird das Bindungsmuster unsicher oder sogar desorganisiert sein, was Verhaltensprobleme verursacht und die Lebensqualität des Hundes massiv negativ beeinflusst.
Co-Regulation
Der Begriff Co-Regulation geht nicht auf eine bestimmte Person oder Forschungsgruppe zurück. Bei der Co-Regulation handelt es sich um ein Konzept, das in der Psychologie, in der Pädagogik und auch der Hirnforschung genutzt wird.
Einfach ausgedrückt beschreibt Co-Regulation den Prozess, wenn eine emotional stabile Person einer anderen Person (damit ist selbstverständlich auch ein Hund gemeint), die sich gerade in einer emotionalen Schieflage befindet, dabei hilft, ihr inneres Gleichgewicht wiederzugewinnen.
Kurz gesagt: Ich kümmere mich um dich, damit es dir wieder besser geht.
Wichtig: Es geht hier NICHT um Gegenseitigkeit! Die Person, die co-reguliert ist in dieser speziellen Situation stabil und bedarf selbst KEINER Co-Regulation.

Ich kümmere mich um dich, damit es dir wieder besser geht. Co-Regulation ist ein Prozess, bei dem eine emotional stabile Person einer anderen Person (oder Hund), der es gerade emotional nicht gut geht, dabei hilft, ihr inneres Gleichgewicht wiederzugewinnen. (Foto von Maria Rehberger: Karo Mayer, Pixelnasen, www.dummytrainerin.at/pixelnasen)
Im Kontext der Mensch-Hund-Beziehung ist Co-Regulation sowohl von Mensch zu Hund, als auch von Hund zu Mensch möglich. Wir können unsere Hunde wunderbar in stressigen und/oder emotional herausfordernden Situationen sozial unterstützen. Genauso tun unsere Hunde das für uns, wenn sie uns beispielsweise mit ihrer Nase anstupsen oder uns anpföteln, wenn wir weinen, weil wir wegen irgendetwas traurig sind. Beispiele, in denen Hunde wirksam beim Menschen co-regulieren, gibt es genug.
Co-Regulation für den Hund ist sinnvoll bei
- Stress, Angst, Unsicherheit, Hektik, Unruhe,
- starken Gefühlszustände wie heftiger Wut, Frustration, Furcht, Aufregung, Freude,
- potentiell traumatischen Erlebnissen,
- allen Situationen, in denen der Hund überfordert erscheint,
sofern er nicht in der Lage ist, sich selbst zu regulieren.
Co-Regulation ist ein AKTIVER Prozess, der eine aufmerksame und präsente Haltung erfordert. Grundsätzlich kann jede Form der liebevollen Zuwendung (bekannt als social support oder auf gut Deutsch soziale Unterstützung) als Co-Regulation gewertet werden, sofern die zugrundeliegende Absicht ist, dass der Hund sich besser fühlt, nicht dass er sich besser verhält. Bei der Co-Regulation geht es um das wertungsfreie Anerkennen der aktuell vorhandenen Emotion und das angemessene Kümmern, um die Bedürfnisse des Hundes in der jeweiligen Situation. Co-Regulation ist aktiv gezeigtes Fürsorgeverhalten gegenüber dem Hund.
Wir geben aktiv Unterstützung, indem wir beispielsweise Körperkontakt anbieten, beruhigend mit dem Hund sprechen und dabei selbst möglichst viel Ruhe und Zuversicht ausstrahlen. Auch das Anbieten oder gemeinsame Aufsuchen eines sicheren Rückzugsortes kann Teil der Co-Regulation sein.
Im Video siehst du, wie Co-Regulation aussehen kann.
Ein unbeteiligtes Danebenstehen, wenn der Hund ausflippt, wie es oft propagiert wird, bei dem der Hund aber keinerlei Beachtung und Zuwendung erfährt, ist keine Co-Regulation, sondern im Wortsinn a-sozial! Es ist ein Hängenlassen des Hundes, der in der Regel keine Möglichkeit hat sich der Situation zu entziehen (weil er durch eine Leine daran gehindert wird), so dass er früher oder später erschöpft aufgeben muss. So etwas dann als erfolgreiche Co-Regulation verkaufen zu wollen ist aus meiner Sicht pervers. Mit positivem Training oder gar bindungsorientiertem Umgang hat das genau gar nichts zu tun.
Die Hirnforschung zeigt, dass Co-Regulation durch neuronale Mechanismen unterstützt wird, die wiederum die Fähigkeit zur Selbstregulation beeinflussen. Co-Regulation ist dementsprechend ein wichtiger Baustein, wenn es darum geht, mittel- und langfristig die Selbstregulation des Hundes zu fördern.
Wirksame Co-Regulation zeigt sich sowohl beim Menschen als auch beim Hund in einem sich beruhigenden Nervensystem: Messbar beispielsweise in einer sich absenkenden Pulsrate, einer Verlangsamung und Vertiefung der Atmung und einer nachlassenden Muskelspannung. Durch diese Beruhigung und weil der Hund sich wieder besser fühlt, ändert sich natürlich auch das gezeigte Verhalten. Jemand, der sein inneres Gleichgewicht wiedererlangt hat, hat schließlich keinen Grund mehr herumzuschreien oder – übertragen auf den Hund – bellend in der Leine zu hängen.
Selbstregulation
Begründer der Selbstregulationstheorie in der Psychologie ist der kanadische Psychologe Dr. Albert Bandura. Bandura war einer der bedeutendsten Psychologen des 20. und 21. Jahrhunderts und einer der Pioniere der Lernpsychologie. Der wird uns später nochmal begegnen, wenn es um die Selbstwirksamkeit und das soziale Referenzieren geht.
Grundsätzlich bezeichnet der Begriff Selbstregulation die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen bewusst zu steuern und anzupassen, um Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu bewältigen.
Sie ist ein innerer Prozess, der einem Lebewesen dabei hilft, das eigene Verhalten zu kontrollieren, Impulse zu unterdrücken und Aufmerksamkeit zu lenken und steht in enger Verbindung zur Selbstwirksamkeit.

Selbstregulation ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen bewusst zu steuern und anzupassen, um Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu bewältigen. (Foto: Maria Rehberger)
Wenn man das Ganze in eine Formel bringen möchte, könnte diese beispielsweise so aussehen:
Selbstregulation
= Emotionsregulation + Impulskontrolle + Aufmerksamkeitssteuerung + Verhaltenssteuerung
Selbstregulation ist entsprechend nicht mit Impulskontrolle gleichzusetzen. Selbstregulation umfasst deutlich mehr, als das bloße Kontrollieren oder Unterdrücken von unmittelbaren Bedürfnissen und Wünschen. Da Impulskontrolle in der Hundewelt ein stark strapaziertes Konzept ist, komme ich dazu im nächsten Abschnitt separat.
Schaust du dir die Formel oben an, wird dir wahrscheinlich schnell klar, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Co-Regulation und Selbstregulation besteht. Mit der Co-Regulation unterstützen wir die Emotionsregulation des Hundes. Er kann sich beruhigen und wird durch verschiedene Lernprozesse mit der Zeit immer besser darin, sich selbst zu regulieren. Unsere Zuwendung sorgt außerdem dafür, dass der Hund seine Aufmerksamkeit nicht mehr ausschließlich auf den Auslöser richtet und wir können dem Hund, sobald er wieder ansprechbar ist, zusätzlich auch noch Möglichkeiten aufzeigen, wie er die Situation gut auflösen kann. Das wiederum wirkt sich mittelfristig auf die Selbstwirksamkeit und Handlungsfähigkeit aus, wodurch eine positive Rückkopplung auf die Selbstregulation stattfindet.
Im Video siehst du Selbstregulation am jagdlichen Auslöser. Bei Hermine leicht unterstützt durch verbale Co-Regulation.
Impulskontrolle
Impulskontrolle beschreibt die spezifische Fähigkeit innerhalb der Selbstregulation, spontane, meistens unüberlegte Reaktionen und Handlungen zu unterdrücken und zu kontrollieren.
Beim Menschen werden durch die Impulskontrolle z.B. bestimmte unmittelbare Bedürfnisse oder Wünsche zugunsten langfristiger Ziele hinten angestellt. Ein Beispiel wäre ein Mensch, der Gewicht verlieren möchte. Das ist das langfristige Ziel. Wenn dieser Mensch an einer Konditorei vorbei geht und auf das verlockende Stück Torte verzichtet, dann ist das Impulskontrolle, weil der Wunsch nach dem Stück Torte aktiv kontrolliert wird.
Beim Hund sehen wir Impulskontrolle dahingehend oft in Zusammenhang mit erlerntem Verhalten. Bei einem Bewegungsreiz stehenzubleiben, anstatt loszurennen, sich hinzusetzen, anstatt einen Menschen anzuspringen, der Essen in der Hand hat und ähnliche Verhaltensweisen erfordern alle Impulskontrolle und werden in der Regel durch den Menschen gefördert. In welchem Umfang Hunde sich eigene Gedanken über “langfristige Ziele” machen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend geklärt.
Ein weiterer Aspekt, bei dem Impulskontrolle sowohl beim Menschen als auch beim Hund eine große Rolle spielt, sind erfolgreiche soziale Interaktionen. Als hochsoziale Spezies ist die Fähigkeit, sich zurückzuhalten, nicht auf jede Provokation sofort zu reagieren, elementar zur Vermeidung von ständigen Konflikten und Auseinandersetzungen.
Die Fähigkeit zur Impulskontrolle ist angeboren, aber sie entwickelt sich erst im Laufe der Kindheit und Jugend. Das liegt daran, dass Impulskontrolle vorrangig durch den präfrontalen Kortex gesteuert wird. Das ist das Vorderhirn, der Bereich, der für planvolles, überlegtes Handeln zuständig ist und der auch für die Verhaltenshemmung sorgt. Und dieser Bereich ist der, der am spätesten vollständig ausreift. Hinzu kommt die Beeinflussung der Impulskontrollfähigkeit durch Neurotransmitter wie beispielsweise Dopamin. Junghunden fällt es deshalb oft besonders schwer, “sich zusammenzureißen”. Das Vorderhirn ist noch nicht vollständig ausgereift, überlegtes Handeln ist also nur eingeschränkt möglich und im Dopaminsystem herrscht während der Jugendentwicklung eine gesteigerte Aktivität, die zu einer gesteigerten Belohnungssensitivität und Risikobereitschaft führt. Entsprechend sind spezielle Übungen zur Verbesserung der Impulskontrolle vor allem während der Jugendentwicklung nicht sinnvoll.
Das Video zeigt deutlich den Unterschied in Sachen Impulskontrolle beim erwachsenen Hund im Vergleich zum Junghund. Während Hermine das Verhalten “Stehenbleiben”, das ich von Welpenbeinen an gefördert und verstärkt habe, problemlos abrufen kann, schafft Maxi das in dieser Situation nicht.
Der Sinn von Impulskontrollübungen ist generell fragwürdig, da die Fähigkeit zur Impulskontrolle auch in engem Zusammenhang mit Bedürfnisbefriedigung, Frustrationstoleranz, Selbstwirksamkeit und dem individuellen Sicherheitsgefühl des jeweiligen Hundes steht. Eine isolierte Betrachtung der Impulskontrolle, die nur einen einzelnen Faktor der Selbstregulation darstellt, wird den hochkomplexen Zusammenhängen nicht gerecht und ist bei der Bearbeitung von Verhaltensproblemen nicht zielführend.

Impulskontrolle: Als hochsoziale Spezies ist die Fähigkeit, sich zurückzuhalten, nicht auf jede Provokation sofort zu reagieren, elementar zur Vermeidung von ständigen Konflikten und Auseinandersetzungen. (Foto: Maria Rehberger)
Selbstwirksamkeit
Bei der Selbstwirksamkeit landen wir wieder bei Dr. Albert Bandura. Er hat nämlich nicht nur die Selbstregulationstheorie in der Psychologie begründet, er ist auch der Entwickler der sozial-kognitiven Lerntheorie (zu der kommen wir dann ausführlicher wenn es um das soziale Referenzieren geht) und hat den Begriff der Selbstwirksamkeitserwartung geprägt.
Selbstwirksamkeit bedeutet, über die Fähigkeiten und Kompetenzen zu verfügen, auch in herausfordernden Situationen, bestimmte Handlungen selbstständig erfolgreich ausführen zu können. Das Wissen um und das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit ist für Mensch und Hund ein ganz entscheidender Faktor, wenn es um das psychische Wohlbefinden geht.
Laut Bandura gibt es vier Faktoren, die das Selbstwirksamkeitserleben entscheidend beeinflussen:
- Eigene Erfolgserlebnisse:
Das erfolgreiche Bewältigen von Aufgaben und Herausforderungen stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und sorgt so für mehr Zuversicht bei künftigen Herausforderungen. - Stellvertretende Erfahrungen:
Anderen, die über ähnliche Fähigkeiten und Kompetenzen verfügen wie man selbst, beim Meistern einer Aufgabe oder Herausforderung zuzuschauen, kann dazu ermutigen, sich selbst ebenfalls an diese Aufgabe/Herausforderung heranzutrauen. - Verbale Überzeugung:
Positive Rückmeldungen anderer, Zuspruch und Ermutigung helfen dabei, das Selbstwirksamkeitsgefühl zu steigern, weil dadurch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt wird. - Physiologische und affektive Zustände:
Das Selbstwirksamkeitsgefühl wird durch den körperlichen und emotionalen Zustand beeinflusst. Stress, körperliche Erschöpfung, Angst und Anspannung verringern das Selbstwirksamkeitsgefühl, die Unsicherheit nimmt zu. Körperliches und psychisches Wohlbefinden, Ruhe und Gelassenheit hingegen sorgen für ein verbessertes Selbstwirksamkeitsgefühl.

Selbstwirksamkeit bedeutet, Fähigkeiten und Kompetenzen zu haben, auch in herausfordernden Situationen, bestimmte Handlungen selbstständig erfolgreich ausführen zu können. (Foto: Maria Rehberger)
Alle vier Aspekte lassen sich wunderbar auch auf den Hund übertragen:
1. Eigene Erfolgserlebnisse:
Egal ob körperliche Herausforderungen wie Kletterübungen, Bodenparcours, das Erkunden neuer, ungewohnter Untergründe, das Überqueren von Brücken und das Balancieren auf Baumstämmen, oder aber Aufgaben, die die Problemlösefähigkeit des Hundes ansprechen, wie z.B. einfache Auspack- und Leckerchen-Such-Spiele, spezielles Intelligenzspielzeug, Nasenarbeit und das Erlernen von Tricks (eine schier unerschöpfliche Quelle an guten Ideen, um Hunden Erfolgserlebnisse zu verschaffen findest du auf der Webseite meiner sehr geschätzten Kollegin Christina Sondermann www.spass-mit-hund.de) und natürlich das erfolgreiche Bewältigen von Herausforderungen im Alltag, wie die gut begleitete Auseinandersetzung mit Angstauslösern, so dass Ängste überwunden werden können, zählen zu den Erfolgserlebnissen, die einem Hund zu einem besseren Selbstwirksamkeitsempfinden verhelfen können.
2. Stellvertretende Erfahrungen:
Wir können unseren Hunden vormachen und zeigen, wie bestimmte Situationen bewältigbar sind. Der Hund darf in einem Abstand zuschauen, in dem er sich sicher fühlt, er wird nicht gedrängt sich zu nähern und auch nicht mit Futter gelockt. Wenn der Hund sich aus eigener Motivation heraus dann traut, unserem Beispiel zu folgen, wunderbar, wenn nicht, dann ist es auch ok und wir lassen es für den Moment gut sein. Mit einem freundlichen “Das war wirklich gar nicht schlimm, vielleicht traust du dich ja beim nächsten Mal auch.” begleitet von einem Lächeln, kann man die Situation dann einfach entspannt verlassen.
3. Verbale Überzeugung:
Hunden immer und immer wieder zu sagen, wie toll, gescheit und mutig sie sind, hat einen riesigen Effekt. Wichtig ist, dass der Zuspruch wirklich ernst gemeint und authentisch ist. Hunde haben ein sehr feines Gespür dafür, wie wir etwas meinen, auch wenn sie die einzelnen Worte vermutlich nicht verstehen. Ermutigende Worte können beim Bewältigen neuer Herausforderungen sehr hilfreich sein und das gemeinsame Erleben fördert zudem auch noch die sichere Bindung.
4. Physiologische und affektive Zustände:
Ein bindungs- und bedürfnisorientierter Umgang hat immer auch das körperliche und psychische Wohlbefinden im Blick und das wirkt sich auch auf das Selbstwirksamkeitserleben positiv aus. Dazu gehört es, Stressoren zu identifizieren, sie zu managen und den Hund dabei zu unterstützen einen besseren Umgang mit ihnen zu erlernen, den Gesundheitszustand des Hundes zu berücksichtigen und Erkrankungen und Schmerzen wirksam zu behandeln und vor allem den Hund in stressigen oder emotional belastenden Situationen nicht allein zu lassen, sondern ihm durch liebevolle Zuwendung und Co-Regulation dabei zu helfen, sich wieder beruhigen zu können.

Selbstwirksamkeit erkennst du bei deinem Hund an
- einer entspannten Körpersprache.
- aufmerksamem, interessiertem Verhalten.
- Neugier und Erkundungsverhalten.
- der Fähigkeit, Probleme selbstständig zu lösen.
- der Fähigkeit, herausfordernde Situationen selbstständig zu bewältigen.
- der Motivation zum Lernen und zur Interaktion.
- einer schnellen Erholung nach herausfordernden Ereignissen.
Hinweise auf ein mangelndes Selbstwirksamkeitsgefühl können sein:
- Generelle Ängstlichkeit
- Pessimismus, depressive Züge
- Rückzug
- Übermäßige Abhängigkeit von der Bezugsperson
- Apathisches, lustlos wirkendes Verhalten
Ein Hund, der über ein gutes Selbstwirksamkeitsgefühl verfügt,
- ist ausgeglichener, gelassener und hat mehr Selbstvertrauen.
- ist weniger ängstlich.
- kann Stress besser abbauen.
- verfügt über eine bessere Frustrationstoleranz.
- hat eine bessere Lebensqualität.
Die Selbstwirksamkeit des Hundes zu fördern ist also keine nette Spielerei, sondern im Sinne des Tierwohls absolut essentiell.

Die Selbstwirksamkeit des Hundes zu fördern ist im Sinne des Tierwohls absolut essentiell. (Foto: Maria Rehberger)
Soziales Referenzieren
Soziales Referenzieren bezeichnet die Orientierung eines Individuums an der emotionalen Körpersprache, insbesondere dem Gesichtsausdruck der Bezugsperson in unvertrauten Situationen, um Informationen über die Situation zu erhalten und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen.
Dieses Phänomen tritt bei Kindern im Alter von 8-9 Monaten zum ersten Mal in Erscheinung und kann auch bei Hunden beobachtet werden.
Die dahinterstehende Lernform ist das Beobachtungs- oder Modelllernen, auch soziales Lernen genannt. Dem Ganzen liegt die sozial-kognitive Lerntheorie von Dr. Albert Bandura zugrunde. Sie besagt, dass Lernen in einem sozialen Kontext mit einer dynamischen und wechselseitigen Interaktion von Person, Umwelt und Verhalten stattfindet und Bandura betont dabei die Wichtigkeit des sozialen Einflusses sowie der externen und internen sozialen Verstärkung.
Jetzt stellt sich vielleicht manch eine Frage: “Jaaaa, aber ist das denn einfach so auf den Hund übertragbar?” Die Antwort darauf lautet ja. Denn die entscheidenden Faktoren der sozial-kognitiven Lerntheorie sind:
- Beobachtungslernen
- Hunde sind exzellente Beobachter ihrer Umwelt und ihrer Bezugspersonen.
- Wechselseitiger Determinismus
- Interaktion zwischen Hund (persönliche Faktoren), Umwelt und Verhalten.
- Verhalten des Hundes beeinflusst die Reaktion des Menschen und der Umwelt, und umgekehrt.
- Selbstwirksamkeit
- Erfolgreiches Bewältigen von Aufgaben und stärkt das Vertrauen des Hundes in die eigenen Fähigkeiten und seine Fähigkeit, mit neuen Situationen umzugehen.
- Verstärkungen
- Positive und negative Verstärkungen spielen weiterhin eine Rolle
- Soziale Verstärkung (z.B. Lob, Aufmerksamkeit, Geborgenheit vom Menschen) ist extrem wirkungsvoll und beeinflusst, welche Verhaltensweisen sie beibehalten.
- Symbolisierungsfähigkeit (rudimentär)
- Symbole wie menschliche Körpersprache, Tonlage, Gesten und Blickrichtung werden genutzt, um die Umwelt zu verstehen und Verhalten zu steuern.
Soziales Referenzieren steht in engem Zusammenhang mit der sicheren Mensch-Hund-Bindung. Wenn der Mensch vom Hund als sichere Basis empfunden wird, wird Erkundungsverhalten auch bei neuen oder potenziell beängstigenden Reizen ermöglicht. Dadurch kommt es überhaupt erst zu Situationen, in denen der Hund die Notwendigkeit verspürt, sich an seinem Menschen zu orientieren und sich bei ihm rückzuversichern. Wenn die Reaktionen und Signale (hier sind keine auftrainierten Signale gemeint, sondern das, was wir durch unsere Haltung und unseren eigenen inneren Zustand ausstrahlen) des Menschen sind immer verlässlich sind und zum Wohlbefinden des Hundes beitragen, wird er eher geneigt sein, diese Signale auch in neuen Situationen aktiv zu suchen und ihnen zu vertrauen.
Soziales Referenzieren zeigt sich beim Hund durch die Beobachtung der emotionalen Körpersprache und Mimik der Bezugsperson in unvertrauten Situationen. Der Hund schaut den Menschen an, um dessen Reaktion auf ein unbekanntes Objekt, eine neue Situation oder eine fremde Person zu deuten. Zeigt der Mensch z.B. Entspannung und Freude, wird der Hund eher neugierig und angstfrei reagieren. Wirkt der Mensch ängstlich oder besorgt, wird der Hund u.U. diesen Gefühlszustand spiegeln und ebenfalls eher ängstlich und verunsichert reagieren. Es ist entsprechend von großer Wichtigkeit, dem Hund vor allem in herausfordernden Situationen ein gutes Vorbild zu sein. Was soll ein Hund beispielsweise von anderen Hunden und Hundebegegnungen halten, wenn der Mensch allein schon bei Sichtung eines anderen Mensch-Hund-Teams die Flucht ergreift oder – was fast noch schlimmer ist – aggressiv reagiert und den anderen Menschen und seinen Hund anschreit, mit großem Getöse vertreibt und dergleichen? Um eine gute soziale Referenz für den eigenen Hund sein zu können, ist einiges an Selbstreflexion und Arbeit an den eigenen Themen notwendig.
Und nein, das bedeutet natürlich nicht, dass einzig und allein wir daran Schuld sind, wenn unser Hund in bestimmten Situationen die Fassung verliert. Jeder Hund ist eine eigenständige Person mit komplexen Emotionen und Gefühlen, Erfahrungen und Charakterzügen. Aber unsere Haltung beeinflusst unseren Hund ganz immens und es liegt in unserer Hand, ob wir unserem Hund eine Stütze sein können oder seine Unsicherheiten und Ängste sogar noch befeuern.

Soziales Referenzieren ist die Orientierung eines Individuums an der emotionalen Körpersprache, insbesondere dem Gesichtsausdruck der Bezugsperson in unvertrauten Situationen, um Informationen über die Situation zu erhalten und das eigene Verhalten entsprechend anzupassen. (Foto: Maria Rehberger)
Fazit
Ich hoffe, dass ich in diesem Artikel die grundlegenden Informationen zu den Begriffen Bindung, Co-Regulation, Selbstregulation, Impulskontrolle, Selbstwirksamkeit und Soziales Referenzieren verständlich erklärt habe. Natürlich ist der dahinterstehende Themenkomplex gewaltig und unterschiedliche Fachrichtungen betrachten ihn aus unterschiedlichen Perspektiven, legen andere Schwerpunkte oder kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen.
Wichtig ist mir an dieser Stelle zu verdeutlichen, wie viel mehr im Zusammenleben mit dem Hund eine Rolle spielt, als die rein behavioristische Lerntheorie und entsprechende Herangehensweisen vor allem an problematische Verhaltensweisen im Alltag mit dem Hund.
Wir sind für unsere Hunde im Normalfall die wichtigsten Sozial- und Bindungspartner und dieser Rolle gilt es Rechnung zu tragen. Hunde sind keine Hühner und keine Wildtiere. Sie haben ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach Bindung zum Menschen. Wenn wir diesem gerecht werden, tun sich noch einmal völlig neue Welten auf und ich kann nur sagen: Das lohnt sich auf ganz vielen Ebenen gewaltig.