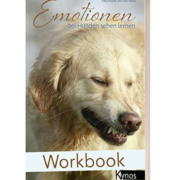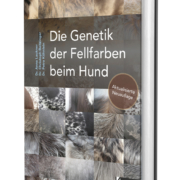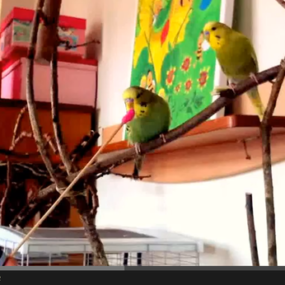Therapiebegleithunde und Assistenzhunde – Welche Hunde sind für diesen Beruf geeignet?
WELCHE HUNDE SIND FÜR DIESEN BERUF GEEIGNET?
Das Feld der Hundeberufe wuchs und veränderte sich in den letzten Jahrzehnten. Aus einigen älteren Hundeberufen wurden Sportarten. Wieder andere werden in unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr gebraucht. Und einige neue Berufe für unsere Vierbeiner wurden gefunden bzw. klar definiert. So auch der des Therapiebegleithundes. Umgangssprachlich wird er auch Therapiehund genannt.
WAS MACHEN “THERAPIEHUNDE” EIGENTLICH?

Bilder: Anja Landler
- Als Therapiehund wird im Allgemeinen ein ausgebildeter und geprüfter Hund bezeichnet, der mit seiner Halter:in für eine begrenzte Zeit in der tiergestützten Intervention eingesetzt wird. Der Hund soll durch seine Anwesenheit und Interaktion mit dem Menschen als Teil eines therapeutischen Konzepts eine positive Auswirkung auf die physische und psychische Gesundheit haben.
Hunde alleine stellen noch keine Therapie dar. Sie fungieren in der tiergestützten Therapie als ideale Begleiter. Daher kommt auch der Begriff „Therapiebegleithund“. Der Begriff „Therapie“ kann ebenso irreführend sein. In den meisten Fällen beinhaltet er sowohl therapeutische, als auch pädagogische, psychologische, sozialintegrative oder andere betreuende, begleitende oder beratende Maßnahmen. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation gehören z. B. auch zum Aufgabengebiet des Therapiebegleithunde-Teams. Sie können Menschen mit kognitiven, sozial-emotionalen und motorischen Einschränkungen und Verhaltensstörungen begleiten. Dies alles fasst man unter dem Begriff tiergestützte Intervention zusammen. Die Hundehalter:in setzt den Therapiebegleithund also für die tiergestützte Intervention in verschiedenen Bereichen ein.
Ein Therapiebegleithund arbeitet mit seiner Halter:in nur für eine kurze, dafür intensive Zeit bis zu zweimal die Woche mit einem Menschen oder mit einer Kleingruppe. In seiner Freizeit ist er ein ganz normaler Hund.
WELCHE HUNDE SIND ALS THERAPIEHUNDE GEEIGNET?

Therapiebegleithunde sind ganz normale Hunde
Sie haben bestimmt schon einiges über Therapiebegleithunde gelesen oder gehört. Und es gibt auch viele Vorurteile gegenüber dieser Ausbildung bzw. dem Einsatz dieser Hunde. Was steckt tatsächlich dahinter?
„Therapiebegleithunde sind doch die armen Hunde, die sich alles gefallen lassen müssen, oder?“
Oder: „Mein Hund lässt sich von meinen Kindern alles gefallen. Die können ihn an den Ohren ziehen und auf ihm reiten und er macht nichts. Der wäre doch gut als Therapiebegleithund geeignet, oder?“ Nein! Therapiebegleithunde sind Lebewesen. Und sie haben ein Recht dazu, auch einmal „nein“ zu sagen. Ein ausgebildeter und geprüfter Hund wird dies auf eine höfliche Art und Weise machen. Und was noch wichtiger ist: Seine Halter:in wird sofort merken, wenn ihm etwas unangenehm ist und ihm in oder aus der Situation helfen. Seine Halter:in ist geschult eine Sitzung so zu gestalten, dass weder bei Mensch noch Tier zu viel Frust oder Stress aufkommen und vor allem niemandem Angst oder Schmerzen zugefügt werden. Auch wenn der Nutzen für den Menschen sehr groß ist: Sobald der Hund Schaden nehmen könnte, ist die hundegestützte Intervention nicht die richtige Therapieform. Es gibt eine Vielzahl von anderen therapeutischen, pädagogischen oder betreuenden Maßnahmen, die in diesem Fall sinnvoller sind.
„Therapiebegleithunde sind doch Hunde, die keine Angst haben dürfen, oder?“ Nein! Angst ist biologisch sinnvoll. Die Verhaltensreaktion auf einen angstauslösenden Reiz ist für uns in diesem Zusammenhang interessant. Ein Therapiebegleithund zeigt eine Verhaltensreaktion in einem bestimmten Rahmen. Würde eine Gehhilfe umfallen und der Hund meidet diesen Platz anschließend aus Angst tagelang, wäre dies erstens ein Zeichen für ein nötiges Verhaltenstraining. Und zweitens einer genaueren Betrachtung wert. Was passiert, wenn der Mensch den Hund in einer solchen Situation unterstützt? Kann er dann besser damit umgehen? Kann die Angst leicht gelöst werden? Sie sehen also, auch diese Fragen sind nicht eindeutig zu beantworten. Würde der Hund jedoch bei einer umfallenden Gehhilfe panisch flüchten, ist er vermutlich nicht für den Einsatz in der Therapie geeignet. Fällt die Gehhilfe um und der Hund weicht zurück, ist dies im normalen Rahmen. Die Gehhilfe kann als Beispiel durch jedes andere Szenario, das im Einsatz denkbar ist, ausgetauscht werden: Der vorbeifahrende Rollstuhl, der schreiende Klient, klappernde Hilfsmittel für die Pflege, quietschende Kinder, gestikulierende Menschen usw. Die Hunde sollten mit ungewohnten Geräuschen und neuen Situationen souverän umgehen können. Darum überprüfen wir die Hunde nicht nur vor, sondern auch während der Ausbildung und vor allem während des Einsatzes findet eine jährliche Kontrolle statt.
„Therapiebegleithunde, das sind doch die Streichelhunde, oder?“
Nicht unbedingt! Wenn Sie das Wort Therapiebegleithund hören, was kommt Ihnen in den Sinn? Vermutlich ein mittelgroßer, heller, kuscheliger Hund, der von Kindern, älteren Menschen, Menschen im Rollstuhl oder Menschen mit Beeinträchtigung gestreichelt wird. Das Bild ist richtig! Es ist jedoch nur ein winzig kleiner Teil unserer Arbeit. Therapiebegleithunde sollten die Berührung von Menschen natürlich genießen. Ansonsten wäre dies nicht der richtige Beruf für sie. Stundenlanges Streicheln oder Kuscheln müssen sie nicht dulden. Auch das Kontaktliegen dürfen sich unsere Hunde aussuchen. Wenn es für den Menschen in Ordnung ist, dürfen sich unsere Hunde zu ihm legen. Wenn sie dies freiwillig anbieten. Und beide, sowohl Mensch als auch Hund, dürfen den Kontakt jederzeit wieder beenden. Für uns ist es sehr wichtig, dass alle Beteiligten freiwillig und mit Freude dabei sind und aufeinander achten. Im Übrigen ist der Beruf des Therapiebegleithundes an keine Rasse, Größe und kein Aussehen geknüpft!
„Der Hund hat mich, als ich an Ihrem Grundstück vorbei ging, angebellt. Der darf doch kein Therapiebegleithund sein, oder?“
oder „Ihr Hund knurrt meinen Hund an, das dürfen Therapiebegleithunde doch nicht!“ Ein Therapiebegleithund ist und bleibt ein normaler Hund. Und darf und soll hündisches Ausdrucksverhalten zeigen. Der richtige Umgang des Menschen mit dem Verhalten des Hundes spielt eine wesentliche Rolle. Der Mensch sollte das Ausdrucksverhalten von Hunden richtig beobachten und interpretieren können. Und wissen, wann und wie er eingreift und wann eben auch nicht!
DER UNTERSCHIED ZUM ASSISTENZHUND
Oft erzählen mir Eltern von beeinträchtigten Kindern: „Ich habe mir auch schon überlegt, für mein Kind einen Therapiebegleithund auszubilden!“ Meist in dem Glauben, dass der Hund in der Familie lebt und ihr Kind unterstützt. Therapiebegleithunde werden jedoch nicht für das Zusammenleben mit einzelnen Menschen ausgebildet. Dafür ist die Hundeberufsgruppe der Assistenzhunde zuständig.
Assistenzhunde sind z. B. Blindenführhunde, Assistenzhund für einen Menschen mit Diabetes/Epilepsie/ PTBS/Autismus, einen blinden Menschen, einen Menschen mit Hörbeeinträchtigung, einen Menschen mit motorischer Beeinträchtigung, u. v. m.. Ein Therapiebegleithund ist ein Besuchshund, der seine Halter:in in einer therapeutischen Maßnahme unterstützt. Ein Assistenzhund lebt mit einem bestimmten Menschen zusammen und ist speziell für diesen ausgebildet.
AUSWAHL, AUSBILDUNG UND PRÜFUNG, EINSATZBEREICHE
- Der folgende Teil beschreibt Regelungen für Österreich. Auf deutsche Verhältnisse wird daher immer am Ende eines Abschnitts eingegangen.
- Die Rolle der Halter:in im Mensch-Hunde-Team
- Die tiergestützte Intervention ist immer Teamarbeit. Halter:in und Tier sollten eine möglichst reibungsarme Kommunikation haben. Der verantwortliche Zweibeiner sollte einen abgeschlossenen Beruf und Berufserfahrung im therapeutischen, pädagogischen, sozialen, beratenden oder betreuenden Umfeld haben. Ist man also im beruflichen oder ehrenamtlichen Umgang mit dem jeweiligen Menschen einigermaßen sicher, kann man sich über den Hund als therapeutisches Medium Gedanken machen. Empathie, Achtsamkeit, Geduld und Lernfreude sind hilfreiche Eigenschaften, wenn man den Weg zum Therapiebegleithunde-Team gehen will.
- Teambildung – Wie finde ich einen passenden Hund?
- Es gibt mehrere Wege, wie man ein geprüftes Therapiebegleithunde-Team wird. In jedem Fall begleitet die Trainer:in Sie in einem Teamwerdungs-Prozess. Eine tiergestützte Intervention ist nur erfolgreich, wenn Halter:in und Hund als echtes Team agieren.
Im Idealfall sucht man sich den Hund aus, in dem man die Mutterhündin und auch den Vater der Welpen gut kennenlernt. Wenn die vierbeinigen Eltern den Kontakt mit Menschen mögen und man einen Eindruck der Lernfähigkeiten gewinnt, kann man sich ein vages Bild über deren Nachkommen machen. Es gibt natürlich keine Garantie, dass die Welpen genauso werden wie ihre Eltern. Es kann jedoch eine Entscheidungshilfe sein.
 Hat man sich für einen Hundetyp und Wurf entschieden, ist natürlich auf die Aufzuchtbedingungen zu achten. Eine reizlose Aufzucht ist ebenso hinderlich wie ein gut gemeintes Überfordern der Welpen. Egal ob Sie sich für einen Welpen entscheiden, oder vielleicht einen älteren Hund aus dem Tierschutz übernehmen: Nach Einzug des Hundes sollte, wie bei jedem anderen Hund auch, genug Zeit für die Eingewöhnung eingeplant werden.
Hat man sich für einen Hundetyp und Wurf entschieden, ist natürlich auf die Aufzuchtbedingungen zu achten. Eine reizlose Aufzucht ist ebenso hinderlich wie ein gut gemeintes Überfordern der Welpen. Egal ob Sie sich für einen Welpen entscheiden, oder vielleicht einen älteren Hund aus dem Tierschutz übernehmen: Nach Einzug des Hundes sollte, wie bei jedem anderen Hund auch, genug Zeit für die Eingewöhnung eingeplant werden.
Im Hundetraining sollten Sie sich für eine Hundeschule entscheiden, die ihren Schwerpunkt auf die Umweltsicherheit der Hunde legt. Die meisten Ausbildungsstätten für Therapiebegleithunde bieten diese Kurse an. Es macht also Sinn, sich gleich dorthin zu orientieren. Auf einem bröckelnden Fundament steht kein Haus! Die Basis für die Alltagssicherheit des Hundes und ein harmonisches Zusammenleben sollten bereits vorhanden sein, bevor der Hund das erste Mal überprüft wird.
Die erste Überprüfung findet mit frühestens 12 Monaten statt. Hierbei geht es um die Eignung von Mensch und Hund zur konkreten Ausbildung zum Therapiebegleithunde-Team. Ist das Team geeignet, dauert die Ausbildung ca. ein Jahr. Der Mensch lernt die Grundlagen des Ausdrucks- und Lernverhaltens, des Stress- und Gesundheitsmanagements des Hundes, der tiergestützten Intervention und die rechtlichen Grundlagen. Er lernt, was tiergestützte Intervention bedeutet, er lernt Therapieziele zu definieren, zu dokumentieren und die Einsätze samt Vor- und Nachbereitungen zu planen. Alle Zweibeiner müssen eine gewisse Anzahl von Beobachtungseinsätzen machen. D. h. sie gehen mit ausgebildeten Teams mit und beobachten die Sitzungen, um Ideen für die eigene Praxis zu sammeln. Darauf aufbauend folgt eine intensive Praxiszeit mit der Festigung der Alltagssicherheit und Grundlagen der tiergestützten Maßnahmen. Im Anschluss werden die Einsätze in Rollenspielen geübt und danach geht es in den assistierten Einsatz in verschiedene Bereiche. Die assistierten Einsätze sind in Österreich gesetzlich für die Ausbildung vorgeschrieben. Es müssen „mindestens 8 Assistenzeinsätze in den letzten 6 Monaten vor Prüfantritt in mind. 2 versch. Institutionen mit mind. 2 versch. Einsatzgebieten…“ nachgewiesen werden.
Der Hund wird veterinärmedizinisch auf Eignung untersucht und darf anschließend zur zweiten Überprüfung antreten. Da in Österreich die Therapiebegleithunde, deren Ausbildung, Überprüfungen und Einsätze durch das Bundesbehindertengesetz geregelt sind, werden die Teams von Sachverständigen gemäß der Richtlinien des Sozialministeriums geprüft und offiziell gelistet. Diese bestandene Prüfung befähigt das Team, selbständig in den Einsatz zu gehen. Insgesamt dauert die Grundausbildung also mindestens 24 Monate. Zur Aufrechterhaltung des Zertifikates und damit der Einsatzfähigkeit muss jedes Team jährlich zur Nachkontrolle durch die Sachverständigen geprüft werden. Dies ist eine wichtige Maßnahme, die eine veterinärmedizinische und Verhaltensüberprüfung beinhaltet.
DR. ANKE GÖRLINGER SAGT DAZU:
“Solche Richtlinien gibt es in Deutschland weder für die tiergestützte Therapie, noch für den Assistenzhundebereich, da Deutschland noch keine gesetzlichen Grundlagen geschaffen hat.
Es gibt einige Institutionen, die sich der Ausbildung von Hunden für die tiergestützte Therapie verschrieben haben, aber auch hier gibt es keine einheitlichen Ausbildungsrichtlinien. Wenn man als Hundehalter:in mit dem Hund im Bereich der tiergestützten Therapie tätig sein möchte, wäre eine geeignete berufliche Vorqualifikation der Hundehalter:in im Bereich Sozialpädagogik, Pädagogik, Physiotherapie, Psychologie, Medizin und den Randgebieten sehr sinnvoll, da ja in erster Linie der Kontakt zum Menschen optimal ablaufen soll und zusätzlich die Fähigkeiten des Hundes geschult werden sollen. Eine Hundehalter:in, der erst noch grundlegende Kenntnisse im Umgang mit den Menschengruppen, für die tiergestützte Therapie in Frage kommt, erlernen muss und zusätzlich ihr Hundetraining auf diese Arbeit abstimmen und erlernen möchte, ist mit dieser Aufgabe sicher meist überfordert.
Interessenten sollten sich unbedingt nach den Qualifikationen der Ausbilder:innen für die Therapiehunde erkundigen, denn dort gibt es meist auch nur Hundetrainer:innen, die keinerlei weitere Vor- oder Weiterbildung im Bereich der tiergestützten Therapie haben und auch manchmal nur fragwürdige Fähigkeiten als Hundetrainer:innen. Auch die Ausbildungsansätze für Hunde in der Arbeit tiergestützter Therapie sind häufig suboptimal. Selbst die Vorlage der Sachkunde nach §11 TschG für Hundetrainer gibt aufgrund der sehr unterschiedlichen Regelungen keine Garantie für einen gut ausgebildeten Trainer:in. Eine umfangreiche und kritische Recherche ist also in Deutschland sehr sinnvoll.”
Therapiebegleithunde können in fast allen Bereichen eingesetzt werden. Sofern man den richtigen Hund für die jeweilige Aufgabe findet.
Mit dem Kinderpsychotherapeuten Boris M. Levinson begann in den 1960er Jahren die Entwicklung der tiergestützten Therapie. Er entdeckte, dass er mit Hilfe seines Hundes Zugang zu Kindern bekam, die er sonst nicht erreichte. Sie wurden durch die Anwesenheit seines Hundes ansprechbar. Im psychologischen und psychiatrischen Umfeld ist der Einsatz von Hunden bereits etabliert. Alleine die Anwesenheit reicht oft schon aus, damit die Therapeut:in einen Zugang zur Patienten:in findet.
Auch in der Pädagogik sind Hunde wunderbare Helfer. Vom Kindergarten bis zur mittleren Reife werden sie sehr gerne für spezielle pädagogische, sozialintegrative Maßnahmen, zur Bewegungsförderung u.v.m. eingesetzt. Hunde können unterstützen, ein stressfreies Umfeld und damit eine gute Umgebung zum Lernen zu schaffen. Sie können in fast jede Form der Sozialarbeit integriert werden. Da sie zur Bewegung motivieren, können sie auch sehr gut zur Gesundheitsprävention eingesetzt werden. Und selbstverständlich sind Therapiebegleithunde aktive und lebendige Helfer, um Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen das Thema Tierschutz näherzubringen.
Die Naturpädagogik beginnt mit der immer stärkeren Urbanisierung eine größere Rolle einzunehmen. Der Hund wird gerne als Bindeglied zur Natur genutzt. Vor allem Kinder finden so einen leichten Zugang zu diesen Themen.
In einigen Formen der manuellen Therapie, Physio- und Ergotherapie etc. kann der Hund zur Motivation eingesetzt werden. Körperliche Anstrengungen werden mitunter bei der Anwesenheit des Therapiebegleithundes nicht als solche empfunden.
Im Senioren- und Pflegebereich bringt der Besuch des Therapiebegleithunde-Teams neben der Abwechslung jede Menge Anregung, Förderung der Motorik und Lebensfreude und Gesprächsstoff für die nächsten Tage.
Der Einsatz von Hunden im Schwerstbehindertenbereich muss gut durchdacht und geplant werden. Nicht jeder Hund, und auch nicht jeder Mensch, ist dafür geeignet. Ist das Verhalten der Klient:in oder Patient:in völlig unkalkulierbar, darf kein Einsatz mit dem Hund geplant werden. Geht kein Risiko vom Menschen für den Hund aus, können diese Sitzungen sehr bereichernd für alle Beteiligten sein.
Auch im Businessbereich können Hunde zur Unterstützung eingesetzt werden. Unternehmensberater:innen können ausgebildete Hunde sehr gut zur Analyse bestehender Themen einbeziehen. In einem Coaching können Therapiebegleithunde unterstützen und begleiten.
 In Österreich dürfen durch die Regelung des Bundesbehindertengesetztes nur ausgebildete Hunde eingesetzt werden. Expert:innen diskutieren, ob es vernünftiger ist, ausgebildete oder grundsätzlich nicht ausgebildete Hunde für die tiergestützte Intervention heranzuziehen. Dabei sollten sie sich meiner Meinung nach noch folgende Frage stellen: Wie wird der Hund überhaupt ausgebildet und was sind die Ausbildungsziele? Ein Hund, der im Einsatz ständig unter Signal steht wird vermutlich nicht sehr viel in die Sitzung einbringen können. Der Vierbeiner soll und muss Emotionen zeigen dürfen, durch sein Verhalten Reaktionen beim Klient:innen oder Patient:innen auslösen. Wenn also Hund und Klient:in oder Patient:in in einem gewissen Rahmen, unter einer gewissen Anleitung frei interagieren dürfen, erzielen wir die besten Ergebnisse. Ein Beispiel dazu: Ich war mit meiner Landseer–Hündin in einer Schule für schwerstbehinderte Kinder im Einsatz. Sie kannte die Kinder und die Räumlichkeiten bereits. Als wir den Raum mit drei Schülern betraten, schnüffelte sie am Spielzeug der Kinder und erkundete den Raum länger als sonst. Ein autistischer Junge saß in der Mitte des Raumes und zwei weitere Kinder lagen auf den Trampolinen in den Ecken der Räume. Es kam, scheinbar, keine Reaktion von dem Jungen und auch nicht von meiner Hündin. Dennoch schritt ich nicht ein, sondern machte mit meinem Ritual weiter. Ich legte den Rucksack ab, richtete das Wasser her und packte die Spielzeuge aus. Meine Hunde dürfen sich im Einsatz aussuchen, womit sie gerne arbeiten. Erst nach mehreren Minuten wendete sich meine Hündin an den Jungen. Beide brauchten an diesem Tag Zeit, um die Nähe zuzulassen. Der Betreuerin musste ich die Situation erst erklären. In ihrer Vorstellung sollte der Hund eine Art Programm machen. Der Junge öffnete sich meiner Hündin in diesem Einsatz so, dass er sogar sein Essen mit ihr teilte und am Ende lagen beide auf einer Matratze und verarbeiteten das Geschehene. Ich hatte in diesen knapp dreißig Minuten nicht viel zu tun. Ich beobachtete Mensch und Hund, bestätigte meine Hündin in den richtigen Momenten und lieferte zur abschließenden Entspannung den Kauartikel.
In Österreich dürfen durch die Regelung des Bundesbehindertengesetztes nur ausgebildete Hunde eingesetzt werden. Expert:innen diskutieren, ob es vernünftiger ist, ausgebildete oder grundsätzlich nicht ausgebildete Hunde für die tiergestützte Intervention heranzuziehen. Dabei sollten sie sich meiner Meinung nach noch folgende Frage stellen: Wie wird der Hund überhaupt ausgebildet und was sind die Ausbildungsziele? Ein Hund, der im Einsatz ständig unter Signal steht wird vermutlich nicht sehr viel in die Sitzung einbringen können. Der Vierbeiner soll und muss Emotionen zeigen dürfen, durch sein Verhalten Reaktionen beim Klient:innen oder Patient:innen auslösen. Wenn also Hund und Klient:in oder Patient:in in einem gewissen Rahmen, unter einer gewissen Anleitung frei interagieren dürfen, erzielen wir die besten Ergebnisse. Ein Beispiel dazu: Ich war mit meiner Landseer–Hündin in einer Schule für schwerstbehinderte Kinder im Einsatz. Sie kannte die Kinder und die Räumlichkeiten bereits. Als wir den Raum mit drei Schülern betraten, schnüffelte sie am Spielzeug der Kinder und erkundete den Raum länger als sonst. Ein autistischer Junge saß in der Mitte des Raumes und zwei weitere Kinder lagen auf den Trampolinen in den Ecken der Räume. Es kam, scheinbar, keine Reaktion von dem Jungen und auch nicht von meiner Hündin. Dennoch schritt ich nicht ein, sondern machte mit meinem Ritual weiter. Ich legte den Rucksack ab, richtete das Wasser her und packte die Spielzeuge aus. Meine Hunde dürfen sich im Einsatz aussuchen, womit sie gerne arbeiten. Erst nach mehreren Minuten wendete sich meine Hündin an den Jungen. Beide brauchten an diesem Tag Zeit, um die Nähe zuzulassen. Der Betreuerin musste ich die Situation erst erklären. In ihrer Vorstellung sollte der Hund eine Art Programm machen. Der Junge öffnete sich meiner Hündin in diesem Einsatz so, dass er sogar sein Essen mit ihr teilte und am Ende lagen beide auf einer Matratze und verarbeiteten das Geschehene. Ich hatte in diesen knapp dreißig Minuten nicht viel zu tun. Ich beobachtete Mensch und Hund, bestätigte meine Hündin in den richtigen Momenten und lieferte zur abschließenden Entspannung den Kauartikel.
Das Vertrauen zu einem Hund kann nicht nur über Füttern und Streicheln hergestellt werden. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist unser Beagle-Clown. Die junge Hündin ist gerne in Bewegung und leistet im Einsatz mit den Kindern der Schule für Schwerstbehinderte großartige Arbeit. Das Team hat u.a. die Aufgabe, den Kindern einen angstfreien und wertschätzenden Umgang mit Hunden beizubringen. Die Beagle-Hündin könnte dabei genauso gut im Zirkus auftreten. Sie macht viele Tricks und Kunststücke und vermittelt durch ihr vertrauenserweckendes Aussehen, die großen, weichen Ohren und ihre geringe Körpergröße sofort Sympathie bei den Kindern. Bei all ihrer Aktivität ist sie dennoch geduldig und sichtbar bemüht, das zu machen, was die Kinder von ihr wollen. Was bei Menschen mit Beeinträchtigung nicht immer so leicht zu erkennen ist!
Kontrovers diskutiert wird das Thema, ob Hunde im Einsatz den Menschen ablecken dürfen oder nicht. Wie bei so vielen Dingen gibt es hier auch keine klare Ja- oder Nein-Antwort. Grundsätzlich gilt: Ist der Mensch oder der Hund damit nicht einverstanden, machen wir es nicht. Den Hund also mittels Aufbringen von Leberwurst oder ähnlichem zum Schlecken zu bewegen ist unangebracht. Genauso sollte der Hund das Schlecken unterbrechen, wenn der Mensch es nicht mag. Ein sensibler Hund wird dies von sich aus tun. Schleckt er weiter, kann dies ein Stresszeichen sein. Ein Beispiel für die Sozialkompetenz unserer Hunde und die Wirkung des Abschlecken bietet uns der Landseer-Rüde mit seinem Frauchen im Pflegeheim. Die Halterin ist in der Pflege tätig und setzt den Hund bei Demenzpatient:innen ein. Der Rüde schleckt gerne im Stress, was der Halterin anfangs Sorgen im Hinblick auf den Umgang mit den Patient:innen bereitete. Die Sorge war unbegründet, denn im Einsatz macht er dies nur, wenn die Patient:in dies auch mag. Er konnte damit schon einige positive Reaktionen von nicht ansprechbaren Patient(inn)en hervorlocken!

Wassertherapiebegleithunde sind Therapiebegleithunde, die eine Zusatzqualifikation erworben haben. Der Hund muss mindestens eine Schulterhöhe von 45 cm haben, gerne und gut schwimmen können und körperlich absolut fit sein. In der Ausbildung steht die Kontrollierbarkeit des Hundes am und im Wasser im Vordergrund. Dies ist besonders herausfordernd, da bekanntermaßen das Wasser das Erregungslevel vieler Hunde steigen lässt. Viele Elemente aus der Wasserrettungshunde-Ausbildung werden für das Training der Wassertherapiebegleithunde verwendet. So lernt der Hund ruhig über kurze und mittellange Strecken neben dem Boot oder Menschen zu schwimmen. Er soll auf Signal Sprünge vom Ufer, Steg und Boot aus ins Wasser absolvieren. Das Apportieren diverser Gegenstände aus dem Wasser gehört genauso zum Ausbildungsprogramm wie das Ziehen von Menschen an Land. Wenn der Hund von sich aus taucht, wird auch dies in das tiergestützte Setting miteinbezogen.
Die möglichen Einsatzgebiete von Wassertherapiebegleithunden sind umfangreich. So können Kinder mit Hilfe der Vierbeiner schwimmen lernen, Menschen mit Angst vor Wasser oder vor tiefem Wasser diese Angst überwinden. Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene, die sonst schwer zu Bewegung motiviert werden können, blühen durch die Anwesenheit der Pfotenfische sichtbar auf. Menschen mit Behinderungen profitieren meist schon von der Wassertherapie und in Kombination mit dem Hund können Elemente aus der Delphintherapie mit dem Hund in heimischer Umgebung durchgeführt werden. Auch blinde Menschen können von dem Einsatz des Hundes im Wasser profitieren. Menschen in physiotherapeutischer Behandlung können in einer Zusatzanwendung im Wasser mit Hilfe des Hundes zur Bewegung motiviert werden. Für mobile Senioren kann der Ausflug an den Strand mit einem Besuch des Hundes und gemeinsamer Aktivität noch ein Gesprächsthema über Tage oder Wochen sein. Auch weniger mobile Menschen können durch den agilen, schwimmenden und laufenden Hund an der Bewegung Freude finden und zumindest in ihrem möglichen Rahmen, wenn es auch nur das Mitdenken ist, aktiviert werden. Letztendlich macht es allen tierfreundlichen Menschen Spaß mit dem Hund im und am Wasser aktiv zu werden.
Der Hund vermittelt im Setting ein Sicherheitsgefühl. Menschen entspannen nachweislich im Beisein eines Vierbeiners und die Fähigkeit, diese Entspannung aufrecht zu erhalten, wird während des Einsatzes gefördert. Gleichgewicht und Koordinationsfähigkeit des Menschen können spielerisch optimiert werden. Bewegung bis hin zur sportlichen Aktivität wird nicht als anstrengend empfunden und kann helfen, Hemmungen gegenüber Bewegungen oder Sport abzubauen. Hunde werten weder beim Aussehen noch beim sozialen Status und können so Menschen mit körperlichen Behinderungen oder übergewichtige Menschen unterstützen. Ganz nebenbei fördert die gemeinsame angeleitete Zeit am und im Wasser die Konzentrationsfähigkeit und bringt Freude und Abwechslung.
Ausblick – Tiergestützte Intervention in ein paar Jahren
Die bewusste, geplante tiergestützte Intervention ist noch sehr jung. Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis lernen wir die Möglichkeiten erst richtig kennen, müssen die Potentiale erforschen. Wir vereinen dabei viele Zweige der Human- und Pflegewissenschaften, Sozialarbeit, Pädagogik, Psychologie, Verhaltensbiologie und Anthrozoologie, die Wissenschaft rund um die Mensch-Tier-Beziehung.
Vielleicht interessieren Sie sich auch für ein Angebot eines Therapiebegleithunde-Teams oder wollen selbst als ein solches arbeiten? Informieren Sie sich und werden Sie aktiv! Jeder neue Einsatz und jedes neue Team trägt zur Weiterentwicklung des Berufsbildes, der Aufgaben und Möglichkeiten bei.
Ergänzung von Dr. Anke Grölinger:
“Auch in Deutschland gibt es Institutionen, die sich um eine vernünftige Reglementierung der Ausbildung von Therapiehundeteams und der Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Interventionen kümmern.
- Die an der Vetuni Wien gegründete ESAAT (European society for animal assisted therapy) hat auch einen Wirkungskreis in Deutschland.
- Die Stiftung „Bündnis Mensch und Tier“ ist ebenfalls um Einheitlichkeit der Richtlinien und Ausbildung bemüht.
Ansprechpartner für die Ausbildung zur Fachkraft für tiergestützte Intervention sind
- FITT, Freiburger Institut für tiergestützte Therapie
- ATN Fernstudium tiergestützte Pädagogik
- Institut für soziales Lernen
- Institut für tiergestützte Förderung
Als Interessent für die Tätigkeit als Therapiehundeteam sind diese Seiten auch sehr informativ und die Ausbildung von Therapiehundeteams bei Absolventen dieser Institute könnten schon recht sinnvoll sein, wobei diese Liste sicher nicht vollständig ist.
Literaturempfehlung:
- Der Schulhund von Meike Heyer, Nora Kloke, Kynos Verlag
 Dr. med. vet. Anke Görlinger, Tierärztin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie, München
Dr. med. vet. Anke Görlinger, Tierärztin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie, MünchenAnke Görlinger hat eine Konsiliarpraxis für Tierverhaltenstherapie, ist Prüferin in Bayern für die Abnahme der Sachkunde nach §11 TschG für Hundetrainer, Gespannprüferin ( BGBFH), Gutachterin bei zahlreichen Problemversorgungen im Assistenzhundebereich, Dozentin für die Ausbildung von Assistenzhundetrainern bei ATN, Multiplikatorin des Bisspräventionsprogramms für Kinder „ Blue dog“.
Ihr Hauptinteresse liegt in der optimalen Ausbildung von Assistenzhunden und deren Haltern, der Novellierung der Ausbildung von Führhunden, der Einführung rechtlicher Grundlagen für Assistenz- und Therapiehunde, sowie einer Prüfungsordnung und -institution in Deutschland.
(Beitrag aktualisiert: Juni 2023)